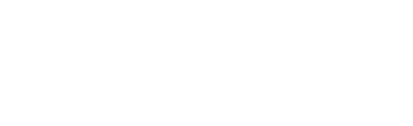Was ist mit Diversität gemeint?
In Anlehnung an den erweiterten Inklusionsbegriff, der sich aus der UN-Behindertenrechtskonvention ableitet, bietet sich ein umfassendes Verständnis von Diversität an, dass bspw. neben Dimensionen wie Geschlecht, Herkunft, Beeinträchtigung und sexueller Identität Teilhabe und Repräsentation als politische Zielvorgaben setzt. Förderung von Diversität im Sinne von Inklusion meint also den Abbau aller einstellungs, struktur- und prozessbedingten Barrieren, die bezwecken oder bewirken, dass Individuen oder diskriminierte Gruppen umfassend, wirksam und gleichberechtigt an der Gesellschaft und ihren Institutionen teilhaben können.
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) gibt entsprechend in § 1 als Ziel vor:
„Benachteilungen aus Gründen der Rasse [einer rassifizierenden Zuschreibung] oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen“.
Warum brauchen wir Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten
Ein Beispiel für die Notwendigkeit und die ersten Erfolge der Erhebung von Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten lassen sich im Rahmen der Strategien zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit aufweisen. Hierbei hat die Datenerhebung gezeigt, wie sich Diskriminierung konkret äußert, und welche Maßnahmen sich daraus zum Abbau von struktureller Benachteiligung ergeben.
Dies bedeutet nicht, dass Diskriminierung von Frauen nicht mehr stattfindet – aber sehr wohl, dass sie immer weniger geduldet wird. Daten, die Diskriminierung von Frauen sichtbar machen, sind eine wichtige Grundlage für weitreichende Gesetze und Fördermaßnahmen. Auch bei anderen strukturell wie institutionell diskriminierten Gruppen ist es notwendig, vergleichbare Maßnahmen zu ergreifen.
Ist das laut Datenschutz nicht illegal?
Nein, im Gegenteil: Die deutsche Bundesregierung hat die UN-Anti-Rassismuskonvention („Internationale Konvention zur Beseitigung jeder Form rassistischer Diskriminierung”, kurz ICERD) ratifiziert und wurde 2015 erneut von dem zuständigen Komitee mahnend darauf hingewiesen, Daten über die nach ICERD schutzwürdigen Gruppen (von Rassismus betroffene Gruppen) zu erheben, um ihrer menschenrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Der Datenschutz sollte und muss jedoch bei der Erhebung differenzierterer Daten unbedingt eingehalten werden, nicht zuletzt, da es sich dabei oft um sogenannte „besondere Arten personenbezogener Daten” (Art. 9 Abs. 1 DSGVO bzw. § 4 Nr. 2 KDG) – also besonders sensible Daten – handelt, deren Erhebung und Verarbeitung nach EU-, Bundes- und Landesdatenschutzvorgaben nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt ist.
Unter welchen besonderen Schutzmaßnahmen werden Antidiskriminierungs- und Gleichstellungs- daten erhoben?
Was sind die Kernprinzipien für die Erhebung von Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten?
- Die Selbstidentifikation der Befragten. Das heißt, die Befragten können selbst angeben, wie sie sich identifizieren. Diese Selbstidentifikation kann sich durchaus von der Fremdzuschreibung durch Dritte unterscheiden.
- Die Freiwilligkeit der Teilnahme. Das heißt, die Befragten müssen der Datenerhebung zustimmen.
- Die Aufklärung über Sinn und Zweck der Datenerhebung.
- Die Anonymität bei der Datenerhebung. Das heißt, dass die Daten anonym erhoben oder so verarbeitet werden, dass im Anschluss nicht mehr nachvollziehbar ist, welche Person, welche Antwort gegeben hat.
- Die Beteiligung von Vertreter*innen von diskriminierten Gruppen am Prozess der Datenerhebung, -analyse und -verbreitung. Das heißt, die von Diskriminierung betroffenen Gruppen werden einbezogen, wenn es um die Entwicklung von Kategorien und Fragen geht, die z. B. der Identifikation einer Behinderung oder der zugeschriebenen „ethnischen” Abstammung dienen.
- Die Möglichkeit, mehrere Identitäten, Diskriminierungsgründe und Fremdzuschreibungen zu wählen. Diese sollten intersektional ausgewertet werden.
Darüber hinaus empfehlen Expertinnen aus der Sintizze und Rom*nja-Community in Deutschland, dass sich Forschende dem „Prinzip der Nichtschädigung” verpflichten, damit Daten nicht missbraucht werden. Daraus ergibt sich ein siebtes Kernprinzip: - Die Einhaltung aller an der Datenerhebung, -auswertung und -anwendungen Beteiligten des Prinzips der Nichtschädigung. Dies wird u. a. durch die Zweckgebundenheit der Forschung gestärkt. So soll sichergestellt werden, dass Daten, die zum Schutz strukturell benachteiligter Gruppen durch differenzierte Erfassung von Diskriminierung erhoben wurden, nicht missbraucht werden.